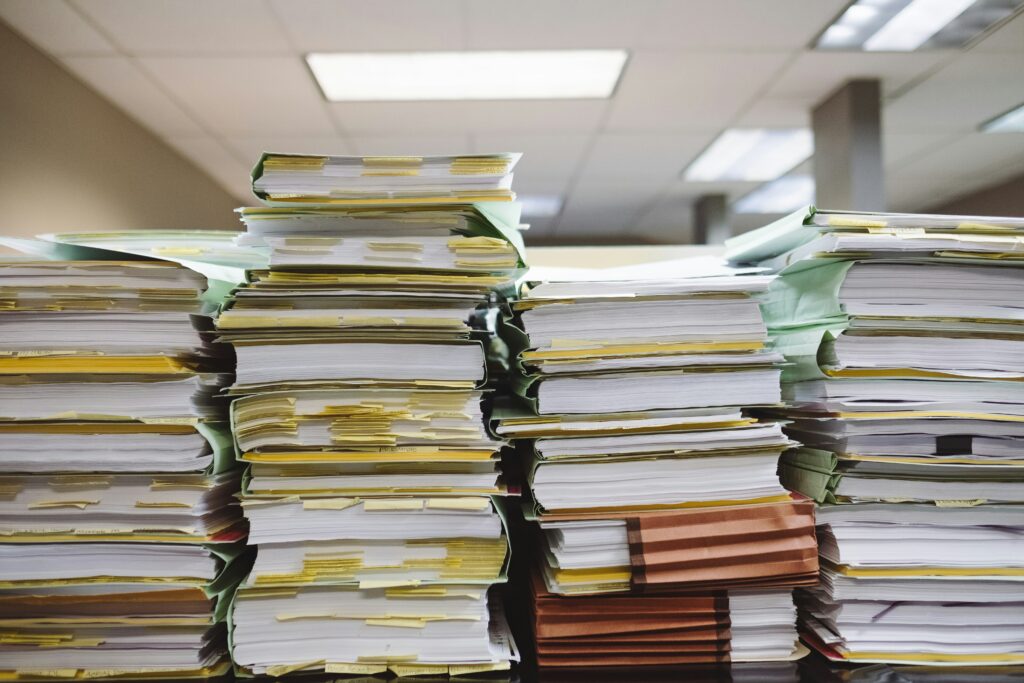Die Frage, was denn Antisemitismus sei und wie man diesen erkennen könne, wird mit recht unterschiedlichen Beweggründen gestellt. Es mag wenige geben, die sie aus echtem Interesse formulieren.
In der Regel jedoch fungiert diese Frage als rhetorische – um sich selbst und sein Milieu von dem angeblich so vagen Verdacht des Antisemitismus befreien zu können.
Denn in vielen dieser Milieus ist das Stigma, man betreibe antisemitische Hetze immer noch mit der Befürchtung verbunden, berufliche oder lebensweltliche Nachteile zu erleiden.
Gleichzeitig wollen sich diese Milieus unablässig Gehör verschaffen, zumindest, wenn es um den Staat der Juden, also um den Juden unter den Staaten geht.
Seit langer Zeit tobt in diesem Zusammenhang der Streit um eine adäquate Definition antisemitischer Handlungen und der sie vorbereitenden Propaganda.
Derzeit wird in der Hauptsache um die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance, kurz IHRA, und die Definition der sogenannten Jerusalemer Erklärung gegen Antisemitismus, kurz JDA, gestritten.
Die Hintergründe dieser Auseinandersetzung wollen wir in dieser und der folgenden Sendung beleuchten.
Nicht zuletzt die Abkehr von der IHRA-Definition durch den neuen sozialdemokratischen Superhelden Mamdani in New York oder auch der Beschluss der Generalversammlung der europäischen Partei Volt, sich nunmehr der JDA-Definition anzuschließen, macht die Aktualität dieser Auseinandersetzung deutlich.
Der Historiker Sebastian Voigt hat sich in einem Beitrag, auf dem die Sendungen beruhen, mit den beiden Definitionen beschäftigt.
In die Debatte mischen sich zudem ein: DJ Koze, Faithless, Milk & Sugar & Nomfusi, Quantic, Sofia Kourtesis, Crookers.
Podcast: Play in new window | Download